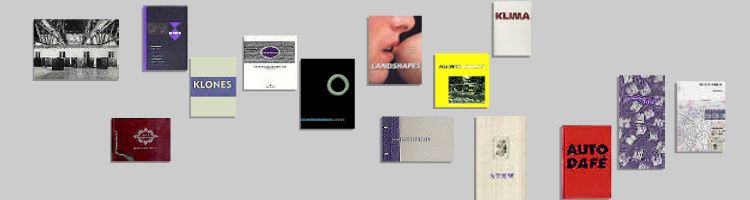|
|
PLEASE CHOOSE ON OF THE PUBLICATIONS FOR TEXTS

MARX Projekt Trier / project Trier
Ein Bild-Lese-Buch, Band / volume 1
Verlag im / published by Karl-Marx-Haus Trier, gebunden / bound, 96 Seiten
/ pages, 16 Farb- und zahlreiche S/W-Abbildungen / colour- and numerous
black and white pictures, deutsch / german
Texte von / texts by Ludwig Hartinger, Dieter Huber, Ivo Kranzfelder,
Barbara Sichtermann, Joscha Schmierer
Karl Marx, der Markt und die Medien
Barbara Sichtermann
Welcher Ökonom, Philosoph, Soziologe von heute wäre nicht stolz
und glücklich, so viel Sekundärliteratur ermuntert zu haben
wie Karl Marx? Allerdings kam der Nachruhm spät, war die Anerkennung
zu Lebzeiten dürftig – doch immerhin, das 20. Jahrhundert vertiefte
sich geradezu in Marx. Exegese, sog. Weiterentwicklung und praktische
Umsetzung seiner Ideen überboten einander an Intensität und
Lärm, bis schließlich irgendwann in den 80er Jahren, also ungegfähr
100 Jahre nach Marx´ Tod, der Zauber verflog und der „Geistes-Heros“
(DDR-Hommage) still beerdigt wurde. Der Mauerfall im Jahre 1989 besiegelte
das Ende der Marx´schen Wirkungsgeschichte. Eine Weile redete man
noch bedauernd oder hämisch davon, daß der große Aufklärer
und Prophet nun endgültig widerlegt sei, dann wurden die Archive
geschlossen.
Für´s erste. Es ist gut möglich, daß der fruchtbare
Denker ein weiteres Mal gleichsam exhumiert wird, und daß sich eine
neue Generation für seine Schriften interessiert; denn es gibt in
ihnen immer noch gute Argumente für das, was am Ende dieses Jahrhunderts
ansteht und auch im nächsten aktuell bleiben wird: die K r i t i
k d e s M a r k t e s . Das frühe 20. Jahrhundert hat Marx vor allem
als Theoretiker der A l t e r n a t i v e interpretiert, als Mann der
Arbeiterpartei, der Pariser Commune, der Gegnerschaft gegen die illegitim
herrschende Bourgeoisie, die das Proletariat ausbeutet. Marx versah die
antibürgerlichen Parteien mit moralischer Munition und optimistischer
Prophetie, er beschaffte Legitimation und Zukunftshoffnung. Ob er, wäre
er in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts noch am Leben gewesen, mit
dieser Rolle hätte Frieden schließen können, muß
offen bleiben. Nach allem, was wir über ihn wissen, dürfen wir
zweifeln. Aber selbst wenn er noch imstande gewesen wäre, Antworten
zu geben, hätte man ihn nicht gefragt. Die russische Revolution hatte
die Karten im Weltpoker neu gemischt, und Marx war Pate einer ebenso energischen
und optimistischen wie terroristischen politischen Kraft geworden. Alles
weitere lief von allein. Sein Name fiel stets, wenn sowjetische Errungenschaften
oder Grausamkeiten zu bewundern oder anzuprangern waren, und die deutschen
Fellow-travellers der KPdSU waren stolz darauf, daß i h r Land den
„Geistes-Heros“ gezeugt hatte. Forcierte Industrialisierung
auf Kosten der Liquidierung großer Teile der Landbevölkerung,
ein unkontrollierbarer, allmächtiger Staatsapparat, der mittels Mord
und Not regiert und das Volk, das er übel manipuliert, weit skrupelloser
noch ausbeutet als alle Zaren zusammegenommen – dafür soll Marx
gleichsam die Vorlage geliefert haben. Natürlich findet sich in seinen
Schriften keinerlei Apologie einer Einparteiendiktatur mit imperialistischen
Ausgriffen. Aber sein Name war und blieb nun mal mitgehangen und mitgefangen,
und er ist für die ahnungslose junge Generation heute ähnlich
blutbesudelt wie der Stalins, Mao Tse-tungs oder gar Hitlers. Zumindest
steht er für das Scheitern einer Vision – und für die Gefahr,
die von einer Vision ausgehen kann, wenn sie sich als ebenso unrealisierbar
wie schwerbewaffnet erwiesen hat.
Marx war kein Pazifist. Und er hat die Diktatur als „Übergang“
zur Freiheit für eine mögliche, eventuell nötige, aber
kurzfristige Lösung angesehen. Seine politische Phantasie war nicht
besonders fruchtbar – das hängt damit zusammen, daß er
in der Ökonomie das dynamische Fundament einer Gesellschaftsformation
erkannt zu haben glaubte und den Institutionen politischer Macht keinen
dauerhaft gestaltenden und umgestaltenden Einfluß auf gesellschaftliche
Strukturen zutraute. Er wollte die Gesellschaft in einer Zone und in einer
Funktion analysieren und dort für eine Umgestaltung werben, die es
w e r t war, um die es sich l o h n t e , weil der ganze Rest: Macht,
Bewußtsein und Moral sich dann von allein mitändern würden.
Schon aus diesem Grund sollte es sich verbieten, Marx als Kronzeugen und
Ideenlieferanten für p o l i t i s c h e Körperschaften wie
z.B. die Kommunistischen Parteien aufzurufen. Er selbst befürwortete
eine politische Organisation der Arbeiter – aber als es dann losging
und das Gründungsfieber ausbrach, hat er diese Organisationsversuche
und ihre Programme immer nur aus den Augenwinkeln verfolgt, kommentiert
und bemäkelt – weil er etwas viel Wichtigeres zu vollenden hatte:
„die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft“, d.h. die
kritische Analyse ihrer Wirtschaft.
Den meisten Scharfsinn, die bewunderungswürdigste Akribie und die
größte Konsequenz steckte Marx in die Untersuchung des Marktes,
also der Tauschbeziehung, also der Ware. Er beließ es nicht bei
der Modellrechnung, wie viele Ökonomen vor und nach ihm, er schwang
sich des öfteren zu kulturkritischen Exkursen auf, d.h. er wies nach,
wie stark der Markt, wenn er nicht mehr nur lokal ist, die Beziehungen
der Menschen prägt, ihr Denken beeinflußt, ihre Seelen affiziert.
Und in dieser Funktion, als Markt-Kritiker, der über die im engernen
Sinn ökonomischen Fragen hinausdenkt, ist Marx bis heute von bemerkenswerter
Aktualität.
Das bedeutet natürlich, daß Marx´ leidenschaftliches
Plädoyer zur Einschränkung der Marktfreiheit um der Freiheit
der Menschen willen, nicht ausgereicht hat, um in uns Heutigen ein Bewußtsein
davon zu wecken, wie problematisch das Steuerungsinstrument ist, dem wir
unsere Ökonomie anvertrauen. Es bedeutet, daß der Markt über
seine Kritiker gesiegt hat. Seine Faszination ist offenbar trotz der zerstörerischen
Dysfunktionen, die diesem Preisbildungs-, Allokations- und Verteilungsmechanismus
innewohnen, nicht zu brechen. Inzwischen weiß jeder, daß der
Markt nicht nur schlecht funktioniert, sondern daß er ungefähr
genauso viel Unheil wie Heil anrichtet – und trotzdem preisen
wir ihn unverdrossen, sind froh, daß wir ihn haben, machen den jüngst
aus der Erstarrung erlösten osteuropäischen Ländern die
schönsten Hoffnungen, sofern sie sich nur uneingeschränkt zur
Marktwirtschaft bekennen – und verschwenden kaum einen Gedanken
daran, wie man den Marktmechanismus einengen, kontrollieren, kompensieren
kann, was man tun muß, um seine destruktiven Tendenzen zu unterdrücken.
Die Sozialdemokratie galt früher als die Partei, die sich diesem
Thema stellte, ja die sogar praktische Konsequenzen aus ihrer Kritik zog
– aber jene Zeiten sind vorbei. Heute gibt es keine politische Kraft
mehr, die über die Marktwirtschaft hinausprojektiert – wer das
täte, setzte sich sofort dem Verdacht aus, er wolle die Planwirtschaft
einführen und das Rad der Geschichte zurückdrehen. Diese Propaganda
funktioniert heute noch genauso gut wie zu der Zeit, als der Eiserne Vorhang
die Welt noch in Blöcke teilte. Und das ist seltsam und bedauerlich,
denn heute existiert kein Gegenentwurf zur Marktwirtschaft mehr –
was Kritik an ihr umso notwendiger macht. Aber auch einfacher, da es die
„falsche Seite“, deren Applaus stören könnte, nicht
mehr gibt.
Was Marx herauspräparierte, als er sich dem Markt kritisch analysierend
zuwandte, war, daß er, der Markt, eine u n p e r -s ö n l i
c h e Steuerungsinstanz ist, daß durch ihn b l i n d e Mächte
über Wohl und Wehe von Kaufleuten, Kapitalisten und Arbeitern entscheiden.
Zu seiner Zeit, als es noch keine Arbeitslosenversicherung gab und auch
noch viel mehr Schwindelfirmen und Kleingewerbetreibende die Wirtschaft
unsicher machten, als das ökonomische Leben noch längst nicht
so starkt v e r r e c h t l i c h t war wie heute, hatten seine Bedenken
die Macht des Faktischen auf ihrer Seite. Mittlerweile hat man in Erfahrung
gebracht, daß gerade das Unpersönliche an der Steuerungsinstanz
Markt sowie ihrem Schmiermittel, dem Geld, seine Vorteile hat. Persönliche
Steuerung durch Bürokratien ist weit schwerfälliger, oftmals
dysfunktional und nie frei von Willkür und Machteinsprengseln wie
Erpressung, Bestechung, Verzögerung usw. Konkurrenz belebt, ist allerdings
wirklich nur das Geschäft; aber geht es bei der Arbeit denn nicht
um mehr? Es gibt durchaus Punkte, an denen Marx´ Markt-Kritik immer
noch greift: die unpersönliche Steuerungsinstanz kennt nur das Geld
als Maßstab, und was sich nicht in Geld ausdrücken läßt,
existiert für sie nicht. Alle Faktoren, die im Wirtschaftsleben sonst
noch eine Rolle spielen wie Ausbildung, Betriebsklima, besondere Chancen
für Benachteiligte, Gesundheitsfürsorge, Erholung, Betriebsfeste,
Bereitschaft zu Überstunden und Lohnverzicht – der ganze „moralische“
Überbau und menschliche Unterbau werden n i c h t vom Markt geregelt.
Und würde er es doch, d.h. risse der Markt auch noch die Zuständigkeit
für diese „menschliche“ Seite des Wirtschaftslebens an
sich, bräche binnen kurzem alles zusammen. Irgendwo muß die
Zone der persönlichen Steuerung beginnen. Und daß der Arbeitsmarkt
von allen Märkten der regulierteste Markt ist, ist kein Zufall.
Die Arbeiter und Angestellten, die täglich in ihre Büros, Werkhallen,
Ateliers, Behörden, Läden usw. strömen, um sich ihr Brot
zu verdienen, sind ja Menschen mit Fähigkeiten, Schwächen, Wünschen,
Ideen Gefühlen, Befürchtungen, Hoffnungen. Dieses Innenleben,
von dem auch die Wirtschaft befruchtet oder gehemmt wird, je nachdem,
läßt seine Leistungen und seine Irrtümer ab einem gewissen
Punkt nicht mehr in Geld messen. Ein Ingenieur, der eine geniale Idee
hat, kann eine Erfindung machen und für sein Patent Geld einstreichen.
Ist die Idee aber „nur“ dazu gut, in seiner Abteilung die Zusammenarbeit
etwas reibungsloser zu gestalten und zu mehr nicht, dann wird er mit dem
Dank seines Chefs vorliebnehmen – hier hört die monetäre
Konvertierbarkeit auf. Und daß solche persönlichen Bande, Beziehungen,
Einflüsse und Reibungen zwischen den Menschen nicht nur erhalten
bleiben, sondern sogar ausgeweitet werden, daß sie nicht durch die
Perfektionierung der Märkte immer weiter schwinden und ausdünnen
– das war eine der Sorgen von Karl Marx. Es war vielleicht sogar
seine größte Sorge; und die größte Hoffnung, die
er in die Überwindung der Marktwirtschaft, in die kommunistische,
als einer gemeinschaftlichen, über personale Steuerung vermittelten
Ökonomie setzte, war die in eine Belebung und Erweiterung der zwischenmenschlichen
Beziehungen – die er in Tausch- und Geldbeziehungen erkalten sah.
Lag er mit dieser Befürchtung so völlig falsch?
Die 90er, auch schon die späten 80er Jahre scheinen sich zu Dekaden
der Markt-Verhimmelung herausmausern zu wollen. Vieles, von dem man dereinst
glaubte, es könne nie und nimmer zu Markte gehen, tritt jetzt den
Beweis des Gegenteils an. Hätte man sich zu Marx´ Zeiten vorstellen
können, daß „Leihmütter“ für Geld die Babies
anderer Eltern austragen, daß menschliche Organe, in „Banken“
tiefgekühlt, Schwarzmarktpreise erzielen? Nicht nur die medizinisch-technischen
Voraussetzungen, die für solche Märkte vorliegen müssen,
hätten Marxens Phantasie überfordert – unglaublich wäre
es ihm auch erschienen, daß die moralischen Schranken, die zu seiner
Zeit sowohl ein solches Angebot als auch die entsprechende Nachfrage unmöglich
gemacht hätten, daß diese Schranken je fallen könnten.
Und hätte er einen vorausahnenen Blick in unsere Zeit werfen können,
hätte er seine Markt-Kritik womöglich noch eine Nuance schärfer
gefaßt.
Was der Markt nicht regeln kann oder soll, übernimmt der Staat oder
sonst eine gemeinschaftliche, kommunale Instanz. Die Arbeiterbewegung
sorgte dafür, daß gewisse Existenzrisiken gerade der Ärmsten
durch Umverteilung vom Staat abgesichert wurden. So kamen die Krankenkassen,
die Arbeitslosenversicherung, die kostenlose Elementarschule in unsere
Welt. Das war ein großer zivilisatorischer Fortschritt und ganz
in Marx´ Sinn. Heute nun versucht man die staatliche Bereitstellung
von Sicherheit, aber auch von Kultur zurückzufahren. Der Markt, heißt
es, könnne das alles besser. Und was sich am Markt nicht halte, habe
kein Existenzrecht.
Ausgangspunkt ist bei der Rechtfertigung jener regelrechten Welle von
Privatisierungen, die seit Anfang der 80er Jahre rollt, meistens der Hinweis
auf die Schwerfälligkeit und Kostenintensität der personalen
Steuerung. Mit ihr ist immer die Gefahr verbunden, daß Herrschaft
sich bürokratisch „verselbständigt“, daß Verschwendung
und Inkompetenz blühen. Damit muß man rechnen, dem muß
man vorbeugen. Diese „Auswüchse“ lassen sich zurückschneiden,
ein bißchen Kontrolle genügt. – Im freien Wettbewerb,
also in der privaten Marktwirtschaft, werden selbstverständlich Kosten
gespart, vor allem Personalkosten, was aber keineswegs bedeutet, daß
die Kunden aufs Beste bedient werden. Als die Telefone noch von der staatlichen
Post betreut wurden, genügte bei Störung ein Anruf, und am nächsten
Tag erschien ein Techniker. Heute, wo das Fernsprechwesen weitgehend privatisiert
ist, dauert es eine Woche, bis jemand kommt, um ein kaputtes Telefon zu
reparieren. Außerdem steigen die Gebühren. So ist das immer
bei der Privatisierung staatlicher Leistungen: der Service verschlechtert
sich, und allles wird teurer.
Ist das nun Schikane? Nein, es bedeutet nur, daß unter w i r t s
c h a f t l i c h e n Gesichtspunkten mit schlechterem Service und zu
höheren Preisen gearbeitet werden kann, und daß wirtschaftliche
Gesichtspunkte vielleicht nicht immer und überall maßgeblich
sein sollten.
Vorher, als alles besser war, ist die Telekommunikation offenbar ein Zuschußgeschäft
gewesen (in bestimmten Bereichen). Der Staat hat Steuergelder drauflegen
müssen, um eine derart preisgünstige Grundversorgung mit Geräten
zu garantieren. Die Frage ist nun: sollte bei gewissen Dienst-, Versorgungs-
oder Versicherungsleistungen die Gesellschaft nicht als ganze j a dazu
sagen, daß der Staat (d.h. sie, die Gesellschaft, mittels ihrer
Steuern) Geld zuschießt? Ist es nicht bei elementaren Voraussetzungen
der Zivilisation wie Gesundheitsfürsorge, Bildung, Kommunikation,
Kultur, Infrastruktur, Verkehr sogar n o t w e n d i g , daß hier
n i c h t unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gehandelt wird, sondern
unter „menschlichen“?? – was immer bedeutet: die Kosten
sind nicht so wichtig wie die Sache, sie werden deshalb von der Allgemeinheit
getragen. Es wird nicht mehr lange so sein, daß der Bewohner eines
abgelegenen Berghüttchens sich sein Telefon zum selben Preis installieren
lassen kann wie der Bewohner eines Ballungsraumes. Früher hielt man
die Telekommunikation für einen so wichtigen Faktor des täglichen
Lebens, daß man fand: für alle müssen dieselben preislichen
Voraussetzungen gelten, wenn sie sich mit ihren Kommunikationswünschen
ins Fernsprechnetz einspeisen, egal, wo sie wohnen. Jetzt wird diese Überzeugung
geopfert. Der Markt und der Preismechanismus fressen ein Stück solidarischer
Menschlichkeit.
Ein anderes Beispiel sind die Radio- und Fernsehsender. In den beiden
öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF hatte sich die Bundesrepublik
eine Medienlandschaft mit starken Trutzburgen gegen eine Trivialisierung
der elektronischen Information und Unterhaltung geschaffen – sie
war lange Zeit zurecht stolz darauf. Inzwischen schnappt der Markt mit
weit aufgerissenem Rachen nach dem Fernsehwesen. Es hat offenbar nicht
ausgereicht, daß vor heuer elf Jahren Frequenzen fürs private
Fernsehen freigemacht wurden; die Existenzberechtigung der überlebenden
Alt-Sender wird immer wieder infrage gestellt – natürlich von
den TV-Markt-Strategen, die ihre politischen Freunde vor allem bei den
Konservativen haben und froh wären, wenn die bedrohliche, da seriöse
und immer noch hochangesehene öffentlich-rechtliche Konkurrenz entfiele.
Was hat das nun alles mit Marx und dem Markt zu tun? Öffentlich-rechtliche
Fernsehsender sind teuer, sie machen – so lautet ihre Verfassung
– nur wenig Werbung, ihre Ausgaben müssen von woandersher gedeckt
werden. Mit G e b ü h r e n , einer Quasi-Steuer, verpflichtet sich
das Zuschauer-Volk, seine öffentlich-rechtlichen Sender zu finanzieren;
es ruft sozusagen im Chor: ja, wir möchten Programmanbieter haben,
die nicht kommerziell orientiert sind, die deshalb immer ein bißchen
zuverlässiger, solider, genauer, geduldiger in der Information und
ein bißchen qualitätsbewußter, minderheitenbezogener
und experimentierfreudiger in der Unterhaltung sein können als Privatsender.
Für die der „Kulturauftrag“ kein leeres Wort und pädagogisch
wertvolles Kinderfernsehen nicht unerschwinglich sind. Und wir sind bereit,
als Fernseh-Nation, dafür Gebühren zu zahlen. – Dieses
– unausgesprochene aber vorhandene und wirksame – konsensuelle
Versprechen der Bevölkerung soll heute nicht mehr gelten. Die den
Markt vergötzenden Politiker wollen es zurücknehmen. Und sie
begreifen wahrscheinlich nicht einmal, daß sie dadurch nicht nur
Arbeitsplätze und ein gutes, erprobtes, lange eingeführtes Programm
bedrohen, sondern auch die Fähigkeit der Gesellschaft, einen personalen,
„menschlichen“ Willen zu formuliern, eine Zone ihres Betriebes
und Bedarfs aus dem Marktgefüge herauszulösen und zu entscheiden:
Wir leisten uns diese Sender (diese Post, dieses Gesundheitswesen, dieses
Theater etc.), wir legen dafür zusammen, das ist es uns wert.
Marx ging es genau um diese Frage: daß und wie die Gesellschaft
einen Weg findet, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, o h n e sich dabei
dem seelenlosen Marktmechanismus auszuliefern. Seine Alternative hieß
allerdings nicht: Staat. Von zentraler Steuerung der Wirtschaft spricht
er nirgends, dafür oft von der „Gesellschaft“ oder dem
„Gemeinwesen“, das seine Ökonomie „unmittelbar“
selbst regeln solle. Wie das im einzelnen zu geschehen habe, wollte Marx
der Praxis überlassen. Er hat da kaum Vorschläge gemacht. Aber
es ist zu vermuten, daß ihm ein Geflecht von gemeinwirtschaftlicher,
genossenschaftlicher, öffentlich-rechtlicher, kommunaler, staatlicher,
und privatwirtschaftlicher Einheit vorgeschwebt hat, wobei die staatlichen
Fernsehsender sich eine Kontrolle ihrer Bürokratie, die privatwirtschftlichen
sich eine Kontrolle ihrer Geschäftspolitik gefallen lassen müßten.
Hier steckt eine Utopie, die druchaus entwicklungsfähig ist. Die
Alternative zum Markt ist nämlich nicht immer nur „der Staat“
in all seiner ökonomischen Inkompetenz – es gibt eine Menge
Zwischenformen, für die unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunksender
ein gutes, erfolgreiches Beispiel sind. Es stimmt auch nicht, daß
der Markt keine „fremden“, als personal vermittelnde Strukturen
nében sich duldet, daß er „rein“ bleiben müsse,
um seine Potenz voll zu entfalten. Seit jeher hat der Staat auch wirtschftliche
Aufgaben erfüllt und den Markt offenbar nicht daran gehindert, sich
weltweit zu verflechten.
Das wichtigste an der „politischen“, personal vermittelnden
Ökonomie ist, daß es bei ihr um Willensbildungsprozesse, um
den Austausch von Vorstellungen, Plänen, Entwürfen geht, um
– wie Marx es nennt - das „Selbstbewußtsein“ des
Gemeinwesens. Der Markt spricht in restringierten Codes, sein letztes
Wort ist immer eine Zahl. Die Gesellschaft aber hat noch andere Sorgen
als nur Geld. Und sie will auch darüber reden. Ein Nebeneffekt der
Markt-Vergötzung in unserer Zeit ist, daß dieses Reden nicht
mehr stattfindet. Hier haben wir ihn, den Grund für die sogenannte
Politikverdrossenheit, über die alle Medien seufzen.
Marx-Devisen.
Notizen zu Dieter Hubers Marx Projekt Trier
Ivo Kranzfelder
I
Anläßlich des sogenannten Zusammenbruchs der realsozialistischen
Systeme des Ostens lancierten die sogenannten C-Parteien dieser Republik
ein Plakat, auf dem ein Marx-Porträt kombiniert wurde mit dem Spruch
"Proletarier aller Länder, vergebt mir!" Ein anderer Spruch,
der kursierte, lautete sinngemäß, der Kapitalismus habe mitnichten
gesiegt, er sei lediglich übriggeblieben. Die Verteufelung von Marx,
wie sie 1989/90 erneut und verstärkt wieder einsetzte — sein
Privatleben wurde hemmungslos in Biographien ausgeschlachtet und mit seinen
Gedanken quasi gleichgesetzt — hat ebenso wie das erwähnte Plakat
etwas Groteskes an sich. Als allerdings aus, wie es hieß, finanziellen
Gründen die weitere Bearbeitung und Herausgabe der MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe)
gefährdet war, hörte der Spaß auf.
"Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft
und idealistische Lebenshaltung!" So könnte man es heute wieder
tönen hören, wäre da nicht der Nachsatz: "Ich übergebe
der Flamme die Schriften von Marx und Kautsky." Die Formeln zur Bücherverbrennung
veröffentlichte der Fränkische Kurier vom 12. Mai 1933. Abgedruckt
ist dieses Dokument in einem der Bücher, die im Überschwange
des 'Sieges' des Kapitalismus und in der immensen medien-, technik- und
fortschrittsbedingten Beschleunigung des Vergessens und des Verdrängens
unter den Tisch gefallen sind. "Die Zerstörung der deutschen
Politik. Dokumente 1871-1933" wurde 1959 von Harry Pross herausgegeben.
Im Kapitel über "Kulturpessimismus" spricht Pross von einer
"hybriden Arbeitslust" des Volkes in dieser Hoch-, wenn nicht
Höchstphase der Industrialisierung, und von der "Auflösung
des Ich durch Arbeit", die erzwungen sein könne, die aber auch
"durch freiwillige Unterwerfung des Menschen unter die verabsolutierte
Arbeit erfolgen" könne. Die Arbeit gewähre dann eine Befriedigung,
die sonst in Abhängigkeit von anderen Lustempfindungen gewonnen werde:
"Solche 'Arbeitstiere' haben in der Hierarchie die besten Aussichten,
weil sie sich deren Apparat mit Haut und Haaren verschreiben und ihn zu
ihrem Lebensinhalt machen. Sie verkörpern eine Art von wirtschaftlichem
Militarismus, denn andere als die Maßstäbe ihres Apparates
lassen sie nicht gelten." Es ist die Rede vom deutschen Kaiserreich
um 1890, etwas über hundert Jahre später sind wir in etwa wieder
dort gelandet — angereichert mit verschiedenen Verfeinerungen wie
Bespitzelung und Verleumdung, bekannt unter dem neudeutschen Ausdruck
"mobbing".
Es mutet unter solchen Umständen fast rührend an, wenn man in
diesem Zusammenhang zurückverweist auf Marx' frühe Kritik an
der Arbeitsteilung, wie er sie in der "Deutschen Ideologie"
formuliert hat. In der kommunistischen Gesellschaft, so führt er
aus, regele die Gesellschaft die allgemeine Produktion und mache es einem
möglich, "heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen,
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu
kritisieren, ohne je Jäger, Fischer oder Hirt oder Kritiker zu werden",
wie man gerade Lust habe. An diese vielzitierte Stelle schloß sein
Schwiegersohn an, der 1842 in Kuba geborene Paul Lafargue, verheiratet
mit Marx' Tochter Laura. Lafargue veröffentlichte 1883, im Todesjahr
von Karl Marx, die Schift "Le Droit à la paresse, réfutation
du Droit de travail de 1848" (Das Recht auf Faulheit, Widerlegung
des 'Rechts auf Arbeit' von 1848).
Dort fanden die utopischen Elemente des frühen Marxschen Denkens
ihre Fortsetzung, gerichtet gegen die bürgerliche Arbeitsmoral, aber
auch in Opposition zur späteren Vergötterung der Arbeit in kommunistischen
Staaten. Dieses lange vergessene und auch heute nur sporadisch und wenn,
dann als Satire wahrgenommene Buch hat 1974 der renommierte Kirchenhistoriker
Ernst Benz zum Anlaß für eine Publikation genommen. Mit unverhohlener
Sympathie und genüßlich zitiert Benz Lafargue, wenn dieser
vom "Haß wider die Arbeit" berichtet oder von den "glücklichen
Völkern, die noch zigarettenrauchend in der Sonne liegen".
Der, wie Benz es nennt, "pathologischen Arbeitswut" setzte Lafargue
die Forderung nach einer maximalen dreistündigen Arbeitszeit pro
Tag gegenüber, weit hinausgehend über heutige Forderungen der
Gewerkschaften. Nicht genug damit, bedauert es der Kirchenhistoriker,
daß noch kein Theologe versucht habe, aus dem Neuen Testament eine
Theologie der Faulheit zu entwickeln. Als schlagenden Beweis zitiert er
in Anschluß an Lafargue die Bergpredigt: "Darum sollt ihr nicht
sorgen und sagen: 'Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit
werden wir uns kleiden?' Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn
euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.
Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen
Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug,
daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe."
Marx hatte ein leicht zwiespältiges Verhältnis zu Lafargue.
Dieser lernte seinen späteren Schwiegervater 1865 in London auf dem
ersten internationalen sozialistischen Studentenkongreß kennen.
Aufgrund der radikalen Ansichten, die er dort vortrug, wurde er von allen
französischen Universitäten ausgeschlossen und beendete sein
Medizinstudium in England. Im Hause Marx verkehrend, umwarb er dort die
Tochter Laura, mit der er sich dann im August 1866 verlobte. Im März
dieses Jahres schrieb Marx an Laura: "Dieser verdammte Schlingel
Lafargue belästigt mich mit seinem Proudhonismus und wird wohl nicht
eher ruhen, bis ich ihm einmal tüchtig etwas auf seinen Kreolenschädel
gegeben habe." Heiraten kann der "Kreolenschädel"
aber erst, wenn er sein Doktorexamen gemacht hat und einige andere Voraussetzungen
erfüllt, wie aus einem Brief von Marx an Engels hervorgeht: "Ich
habe aber noch gestern unserem Kreolen mitgeteilt, daß, wenn er
sich nicht zu englischen Manieren down kalmieren kann, Laura ihn ohne
Umstände an die Luft setzen wird. Dies muß er sich völlig
klar machen, oder es wird nichts aus der Sache. Er ist ein kreuzguter
Kerl, aber enfant gâté und zu sehr Naturkind."
Wie es bei dumpfer Polemik der Fall zu sein pflegt, werden Menschen mit
unliebsamer Wirkung dadurch verunglimpft, daß man ihnen ihr Menschsein
vorwirft, bei Politikern und amerikanischen Filmschauspielern eine beliebte
Methode. Wenn die an den Trend der Zeit sich Hängenden Marx' Verhältnis
zu seiner langjährigen Haushälterin Helene Demuth, aus dem ein
Sohn hervorging, als Beweis seiner auch sonstigen Schlechtigkeit hernahmen,
dann kann man auch fragen, warum sie seine Karbunkel, die im übrigen
von Lafargue behandelt wurden, nicht in dieser Weise ausschlachteten.
Das utopische Element der Marxschen Denkansätze zählt nicht
mehr zu einer Zeit, die sich nach Aussage neuerer Ideologen von der Utopie
verabschiedet hat. Die Zeit der großen Erzählungen, so heißt
es, sei vorbei. Die eine große Utopie, die marxistische bzw. die
kommunistische, ist in ihrer versuchten Verwirklichung gescheitert, die
Verwirklichung der anderen, der christlichen, hält sich — mit
in letzter Zeit nachlassendem Erfolg — seit beinahe 2000 Jahren.
Es zeigt sich, daß die metaphysische Begründung einer Ideologie
wirksamer ist als die materialistische. Die crux besteht darin, daß
eine Utopie zum Zeitpunkt ihrer 'Verwirklichung' aufhört zu existieren,
geht man rein vom Wortsinne aus: der griechische Begriff meint den "ou-topos",
den Nicht-Ort, das Nicht-Existente. Man könnte also schlußfolgern,
daß die Institution Kirche mit der Lehre Christi ebensowenig zu
tun hat wie der real existierende Sozialismus mit der Lehre von Marx.
Als Ausgangspunkt des Christentums gilt das Neue Testament, als der des
Marxismus die Schriften von Marx und Engels. Nun ist diese jeweilige Basis
auch nur eine scheinbare. Im Falle des Marxismus meinte dazu Iring Fetscher:
"Die Geistesgeschichte des Marxismus ist ein Teil der abendländischen
Geistesgeschichte. Wie jeder Teil eines größeren historischen
Ganzen kann auch dieser nicht ohne Gewalttätigkeit isoliert werden.
Man könnte die Quellen Marxschen und marxistischen Denkens nach rückwärts
bis zur antiken Philosophie und zur jüdisch-christlichen Theologie
verfolgen und zugleich nach vorwärts bis zur Gegenwart, in der europäischer
Marxismus mit außereuropäischen Weltreligionen und Kulturen
sich vermischt." Ähnliches gilt mutatis mutandis auch für
das Christentum. Arno Schmidt bemerkte dazu polemisch: "Solange man
als die reinste Quelle 'Göttlicher Wahrheit', als heilige Norm der
'Vollendeten Moral', als Grundlage von Staatsreligionen ein Buch mit,
milde gerechnet, 50 000 Textvarianten (also pro Druckseite durchschnittlich
30 strittige Stellen!) proklamiert; dessen Inhalt widerspruchsvoll und
oft dunkel ist; selten auf das außerpalästinensische Leben
bezogen; und dessen brauchbares Gute (schon vor ihm und zum Teil besser
bekannt) auf unhaltbaren Gründen eines verdächtig-finsteren
theosophischen Enthusiasmus beruht: solange verdienen wir die Regierungen
und Zustände, die wir haben!"
II
Kommen wir noch einmal zurück auf das "Recht auf Faulheit",
das, utopische Vorstellungen des jungen Marx aufgreifend, harsche Kritik
am "Recht auf Arbeit" übt, einem Recht, das später
zu einer sakrosankten Formel des Kommunismus geworden ist. Es wurde schon
von Fetscher wie auch von Benz darauf hingewiesen, daß Lafargues
Ansatz in einer ursprünglich romantischen antibürgerlichen Haltung
wurzelt, bei Friedrich Schlegel, Oscar Wilde oder Charles Baudelaire.
Letzterer schrieb in "Mon cœur mis à nu": "Was
mich groß gemacht hat, war zum Teil der Müßiggang. Zu
meinem großen Nachteil; denn ohne Vermögen vermehrt der Müßiggang
die Schulden und die Schmählichkeiten, die das Schuldenmachen mit
sich bringt.
Zu meinem großen Vorteil jedoch, was die Reizbarkeit der Empfindung,
die Meditation und die Begabung zum Dandy und Dilettanten betrifft. Die
anderen Schriftsteller sind zum größten Teil sehr unwissende
Lumpen und Streber." Was Baudelaire hier anspricht, könnte man
parallel sehen zu Marx' Kritik an der entfremdeten Arbeit. Wenn man die
Tätigkeit des Künstlers als prototypisches Beispiel nicht-entfremdeter
Tätigkeit sieht, also von einer Autonomie der Kunst ausgeht, müßte
das Marx eigentlich entgegengekommen sein. Dem ist aber nicht so. Wieder
in der "Deutschen Ideologie" wendet Marx sich gegen Max Stirners
Behauptung, daß beispielsweise Raffaels Arbeit niemand ersetzen
könne: "Sancho [d.i. Stirner; I.K.] bildet sich ein, Raffael
habe seine Gemälde unabhängig von der zu seiner Zeit in Rom
bestehenden Teilung der Arbeit hervorgebracht. Wenn er Raffael mit Leonardo
da Vinci und Tizian vergleicht, so kann er sehen, wie sehr die Kunstwerke
des ersteren von der unter florentinischem Einfluß ausgebildeten
damaligen Blüte Roms, die des zweiten von den Zuständen von
Florenz und später die des dritten von der ganz verschiedenen Entwicklung
Venedigs bedingt waren. Raffael, so gut wie jeder andere Künstler,
war bedingt durch die technischen Fortschritte der Kunst, die vor ihm
gemacht waren, durch die Organisation der Gesellschaft und die Teilung
der Arbeit in seiner Lokalität und endlich durch die Teilung der
Arbeit in allen Ländern, mit denen seine Lokalität in Verkehr
stand. Ob ein Individuum wie Raffael sein Talent entwickelt, hängt
ganz von der Nachfrage ab, die wieder von der Teilung der Arbeit und den
daraus hervorgegangenen Bildungsverhältnissen der Menschen abhängt."
An anderer Stelle heißt es dann noch, es gebe in einer kommunistischen
Gesellschaft keine Maler, sondern höchstens Menschen, die unter anderem
auch malen.
Nach der Doktrin marxistisch-leninistischer Ästhetik ist die Kunst
integriert in den historischen, materiellen, sozialen und kulturellen
Prozeß der Produktion und Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens.
Gegen einen solchen 'mechanischen Materialismus' führte der Kunsthistoriker
Max Raphael eine Stelle aus der Einleitung zur "Kritik der politischen
Ökonomie" an, in der Marx die Frage stellt, warum die griechische
Kunst einen "ewigen Reiz" und einen normativen Charakter besitze,
obwohl ihre wirtschaftlichen Grundlagen längst überwunden seien.
Raphael leitet von dieser Bemerkung eine Differenzierung der dogmatischen
marxistisch-leninistischen Ästhetik ab, die in eine Methode mündet,
die eine Alternative bildet zu reiner Stilgeschichte, Künstlergeschichte
oder Ersatzreligion: "Die ökonomische Situation mit der geschichtlich
jeweils konkreten materiellen Produktion und Reproduktion des Lebens wirkt
notwendig, aber nicht automatisch auf das geistige Schaffen. Es gibt in
diesem Abhängigkeitsverhältnis keinen vollkommenen Determinismus,
weil die Menschen, wenn auch 'in einem gegebenen, sie bedingenden Milieu,
auf Grundlage vorgefundener, tatsächlicher Verhältnisse' (Engels)
ihre Geschichte selbst machen." Dabei unterscheidet Raphael in der
wissenschaftlichen Kunstbetrachtung zwischen einer synthetischen und einer
materialistisch-dialektischen Geschichtsauffassung. Erstere begreift er
als reines Agglomerat, letztere als "einheitliche Wissenschaft der
Geschichte", die "nur möglich ist auf Grund durch Begriffe
konstituierter Wissenschaften aller Gebiete". Gemeint ist also, daß
es einen Zusammenhang, sogar eine behauptete Homologie, gibt zwischen
historischer gesellschaftlicher Entwicklung und dem individuellen künstlerischen
Schaffensakt unter Berücksichtigung oder gerade trotz ihrer Unterschiede;
daß die Methode der Betrachtung der verschiedenen zu berücksichtigenden,
wie Raphael es nennt, "Bewußtseinsgebiete" gleich ist;
und schließlich daß mit dieser Methode eine konkrete Analyse
aller anstehenden Probleme möglich ist.
Was Raphael im Aufsatz "Prolegomena zu einer marxistischen Kunsttheorie"
ausführt, hat er anhand der Werkinterpretation von Corots "Römischer
Landschaft" in Kürze geäußert. Man müsse, so
meint er, "der Methode der künstlerischen Gestaltung, die von
einem Individuum vollzogen wird, die Methode (oder Methoden) der Geschichtsgestaltung"
gegenüberstellen, "die von der ganzen Gesellschaft (als ein
Begriff gegensätzlicher Klassen) vollzogen wird, und indem man den
partiellen Zusammenhang zwischen beiden in Form und Inhalt des Kunstwerks
nachweist". Aufschlußreich ist hier der einschränkende
Zusatz "partiell", der verdeutlicht, was Marx selbst mit seiner
Bemerkung über die griechische Kunst andeutete, und was auch durch
überbrückende Hilfskonstruktionen nicht auszumerzen ist, nämlich
den letztendlichen Rätselcharakter von Kunst. Adornos Diktum spricht
hier eine deutliche Sprache: "Kunstwerke, die der Betrachtung und
dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine." Das impliziert auch,
daß eine wie auch immer geartete Indienstnahme von Kunst scheitern
muß, sei es auf Kosten der indienstnehmenden Institution (selten)
oder sei es auf Kosten der Kunst (meistens). Ob es sich hierbei um ein
demokratisches oder ein diktatorisches System handelt, spielt überhaupt
keine Rolle.
Ein Kernpunkt bei der Betrachtung von Kunst — und zwar sowohl alter
wie auch neuer Kunst — ist die Empirie, gemäß dem zwar
überstrapazierten, aber nicht gänzlich von der Hand zu weisenden
Satz von Marx, daß nicht das Bewußtsein das Leben, sondern
das Leben das Bewußtsein bestimme. Während die gängige
Kunstkritik in vielen Fällen sich in religiös-idealisierenden
Phrasen ergeht, ist es höchste Zeit, wieder an Tugenden zu erinnern,
die allgemein Marx formuliert und an die speziell für die Kunstwissenschaft
Aby Warburg in gewisser Weise angeknüpft hat: "Das enthusiastische
Staunen vor dem unbegreiflichen Ereignis künstlerischer Genialität
kann nur an Gefühlsstärke zunehmen, wenn wir erkennen, dass
das Genie Gnade ist und zugleich bewußte Auseinandersetzungsenergie.
Der neue grosse Stil, den uns das künstlerische Genie Italiens beschert
hat, wurzelte in dem sozialen Willen zur Entschälung griechischer
Humanität aus mittelalterlicher, orientalisch-lateinischer 'Praktik'."
Entscheidend ist wiederum das Verhältnis zwischen individueller künstlerischer
Betätigung, der Ideen- und Geistesgeschichte und den das Künstlerindividuum
umgebenden materiellen Bedingungen.
III
Karl Marx ist, nicht zuletzt durch Kampagnen wie die anfangs erwähnte,
endgültig zur persona non grata geworden. Marx, Lenin, Stalin und
alle möglichen Diktatoren, die sich auf Marx beriefen und, vereinzelt,
noch berufen, werden in einen Topf geworfen. Die Zahl derer, die sich
an philosophischen Seminaren der Universitäten mit Marx beschäftigen,
sinkt ständig. Dagegen ist es ein Allgemeinplatz, daß Marx
zwar einer der meist zitierten — und sei es nur der Schlußsatz
aus dem Kommunistischen Manifest — aber am wenigsten gelesenen Autoren
ist. Wer heute noch mit Marx daherkommt, wird allenfalls belächelt.
Eine 'Ästhetik' von Marx existiert nicht, etwas ähnliches wurde
versuchsweise von sowjetischen Kunstwissenschaftlern aus verstreuten Zitaten
zusammengestellt, erwähnt sei nur Michail Lifschitz' Anthologie mit
dem Titel "Marx und Engels über die Kunst". Wichtig ist
— ähnlich wie bei Freud — in diesem Falle die Methode,
nicht die konkrete Untersuchung. Wer den Komplex Marx und Kunst unter
dem Stichwort "Sozialistischer Realismus" abtut, liegt falsch.
Dieser, das nebenbei, wurde vorbereitet in der Resolution "Über
die Politik der Partei auf dem Gebiet der belletristischen Literatur"
des Zentralkomittees der sowjetischen Kommunistischen Partei aus dem Jahr
1925 und als offizielle Kunst dekretiert 1934 auf dem ersten Kongreß
der Sowjetschriftsteller in Moskau.
Daß eine Veränderung der Welt durch Kunst oder durch Philosophie
nicht möglich ist, das hat Marx in der elften seiner "Thesen
über Feuerbach" schon impliziert. In den späten 20er und
frühen 30er Jahren dieses Jahrhunderts war die Diskussion im Schwange,
den Künstler in der revolutionären Aktion aufgehen zu lassen,
und zwar auf Kosten der Kunst: "In Wahrheit handelt es sich viel
weniger darum, den Künstler bürgerlicher Abkunft zum Meister
der 'Proletarischen Kunst' zu machen, als ihn, und sei es auf Kosten seines
künstlerischen Wirkens, an wichtigen Orten dieses Bildraums in Funktion
zu setzen. Ja, sollte nicht vielleicht die Unterbrechung seiner 'Künstlerlaufbahn'
ein wesentlicher Teil dieser Funktion sein?" — soweit Walter
Benjamin 1929.
Erneut flammte die Debatte um Autonomie oder Aufhebung der Autonomie der
Kunst in den 60er und 70er Jahren auf. Lange Zeit wurde danach der Satz
Adornos diskutiert, Kunst werde zum Gesellschaftlichen durch ihre Gegenposition
zur Gesellschaft, und jene Position beziehe sie erst als autonome. Die
dann ausgerufene Postmoderne propagierte mit Achille Bonito Oliva und
dem deutschen Apostel der Postmoderne, Wolfgang Welsch, der Künstler
wolle nicht mehr der ästhetische Handlanger oder Propagandist einer
gesellschaftlichen Utopie sein. Die Philosophie der Postmoderne, die sich
hierzulande, in schon von Marx gegeißelter deutscher Art, größtenteils
auf polemische Apologetik beschränkte, nannte sich nach dem Franzosen
Lyotard "affirmativ" und fand infolgedessen höchste Akzeptanz.
Zur Zeit herrscht relative Stille, mehr als affirmativ kann man sich nur
in Überanpassung verhalten, und die schlägt leicht ins Gegenteil
um, ist also potentiell gefährlich. Wir sind jetzt wieder an dem
Punkt angelangt, der am Beispiel der Arbeit zu Beginn dieser Ausführungen
erwähnt wurde.
Hier setzt Dieter Huber an. Gegen die dümmliche Technik des Propagandaplakats
setzt er subtilere Strategien. Als Ausgangsmaterial benutzt er fotografische
Aufnahmen von Karl Marx und Begriffe, die sowohl in Werk und Leben von
Marx als auch für Huber selbst im Zusammenhang mit Marx eine Rolle
spielen. Huber operiert mit Bild und Schrift oder, anders ausgedrückt,
mit Anschauung und Begriff. Auch ihm geht es, um Warburg zu paraphrasieren,
um die Entschälung einer Humanität aus gegenwärtiger Praxis,
nur daß ein sozialer Wille dazu zur Zeit nicht in Sicht ist. Begriff
und Bild sind nicht homolog, nicht tautologisch, nicht affirmativ. Sie
weisen assoziative Bezüge zueinander auf. Jedoch ist Huber weit davon
entfernt, seine Arbeiten ausschließlich der freischwebenden Assoziation
des Betrachters zu überlassen oder reinen künstlerischen Subjektivismus
darzubieten, der dann freigegeben wird zur Anbetung durch Kunstjünger.
Inhalte und Begriffe werden reflektiert, die zwar zu Phrasen verkommen
sind, deren eigentliche Bedeutung aber noch nicht verschüttet ist.
Max Raphael schrieb zu Beginn der 40er Jahre: "Für Marx war
die Mythologie ein Volksprodukt, für die Künstler und Ästhetiker
des 20. Jahrhunderts lag der Reiz gerade in der persönlichen Umformung
des Inhalts, so daß schließlich der unsinnige Begriff einer
privaten Mythologie wahre Triumphe feierte." — Man erinnere
sich an Harald Szeemanns "Individuelle Mythologien" 1972 auf
der documenta 5. Huber hat die Fotografien von Karl Marx fragmentiert
und verfremdet, manchmal bis zur Unkenntlichkeit. Die Begriffe sind den
Bildern eingeschrieben, auch sie sind teils gut, teils weniger gut lesbar.
Ihre Verbindung mit dem Bildgrund gehen sie oft dadurch ein, daß
die Struktur des Grundes sich im Schriftbild fortsetzt. Die Begriffe sind
jeweils farblich vom Fond abgesetzt. Die Schriftarten variieren und erzeugen
bestimmte Konnotationen zu jedem Begriff. Diese wechseln, d. h. sie können
dem Begriff entsprechend sein, ihm entgegengesetzt sein oder sich außerhalb
seines Bedeutungsfeldes bewegen. So ist beispielsweise der Begriff "Individuum"
in einer entindividualisierten, serifenlosen Schrift auf ein nicht zu
entschlüsselndes graphisches Detail gesetzt, und zwar ohne daß
der Bildgrund im Schriftbild durchschlüge.
Huber kombiniert traditionelle Techniken und Methoden mit modernsten Produktionsmitteln.
Die als Basismaterial verwendete Fotografie wird mittels eines Rechners
digitalisiert und verfremdet. Ein Schlüsselbegriff ist der der "Reproduktion":
Vielfach, vor allem durch den enormen Industrialisierungs- und Technisierungsschub
im 19. Jahrhundert führt der Weg von der einfachen Produktion zur
Reproduktion. Davon ist die Bildherstellung nicht ausgenommen. Es ist
kein Zufall, daß die Erfindung des Massenmediums Fotografie in die
Zeit der industriellen Revolution fiel, in die Zeit der Ausbildung des
kapitalistischen Wirtschaftssystems, in die Zeit der Entwicklung der Naturwissenschaften
und schließlich in die Zeit der Herausbildung moderner Staatsgebilde
in der Nachfolge der Französischen Revolution. Die Reproduktion von
Bildern setzt zwar schon mit der Entwicklung druckgraphischer Techniken
ein, erreicht aber mit der Erfindung der Fotografie einen Höhepunkt.
Die Fotografie, die dem Begriff "Reproduktion" unterlegt ist,
zeigt einen Ausschnitt aus einem Bildnis von Marx während seiner
Zeit als Chefredakteur der "Neuen Rheinischen Zeitung" in den
Jahren 1848/49. Die Fotografie war damals gerade zehn Jahre alt, im Revolutionsjahr
1848 wurde das "Manifest der Kommunistischen Partei" veröffenlicht.
Mehrere Ebenen von "Reproduktion" sind hier übereinandergelagert
und durchdringen sich auf vielfältige Weise: das Reproduktionsmedium
Fotografie, das der Zeitung — Marx also reproduziert in Bild und
Wort —, die Reproduktion Hubers in seiner Arbeit und der Begriff
der Reproduktion selbst. Im Buch ist dann wiederum die Reproduktion dieser
vielfältigen Reproduktion zu sehen.
Der gewählte Ausschnitt zeigt den Teil eines Stuhles, auf dessen
Lehne Marx seine Hände gelegt hat, weniger sich stützt, und
seinen Hut, der auf der Sitzfläche liegt, gewissermaßen die
materiellen Zutaten und Accessoires einer bürgerlichen Atelierfotografie:
Reproduktion als Zubehör. "Die Bourgeoisie reißt durch
die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich
erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in
die Zivilisation… Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise
der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen;
sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen,
d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach
ihrem eigenen Bilde." So steht es im "Manifest der Kommunistischen
Partei".
Ausschnitt oder Close-up sind oft angewandte Techniken der Werbung bzw.
der Propaganda, meist in Verbindung mit Schrift. Ein solches Verfahren
hat einen Ursprung in der Emblematik, genauer gesagt in einer Abart des
Emblems, in der Devise. Ein Emblem besteht aus drei Teilen, dem Motto
(Lemma), dem Bild (Icon) und dem erklärenden Epigramm. Lemma und
Icon bilden ein Rätsel, dessen Lösung durch das Epigramm ermöglicht
wird. In der Devise steht oft der Text im Bild, das Epigramm fehlt, weil
der Sinn auch ohne es erschlossen werden kann. Pierre J. Vinken hat schon
in den späten 50er Jahren den Zusammenhang zwischen Emblematik und
Werbung erkannt. Zur ursprünglichen Funktion der Devise schrieb er:
"Die Devise wurde gepriesen, weil sie klein war und doch inhaltsreich,
tiefsinnige Gedanken in eleganter Form in sich barg und durch ihre Schlichtheit
und Geschlossenheit alle anderen intellektuellen Produkte bei weitem übertraf."
Das trifft auf Werbung nur bedingt zu, da diese im Dienste des Produkts
plakativ und auf Anhieb verständlich zu sein hat. Dagegen stehen
die Arbeiten Hubers in ihrer Reduziertheit, der Konzentriertheit des Gedankens
und der Form in dieser Tradition. Es sei ergänzend noch bemerkt,
daß die Arbeiterorganisationen des 19. Jahrhunderts häufig
Devisen auf ihren Fahnen trugen.
War die Fotografie zu Marx' Zeit das fortschrittlichste Produktions- und
Reproduktionsmittel für Bilder, so ist es heute der digitale Rechner,
der Computer. Es ist also folgerichtig, daß Huber in Analogie sich
dieses Hilfsmittels bedient, um seine Zwecke auf der technischen Höhe
seiner Zeit dementsprechend zu realisieren.
|
  |